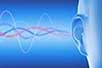Belastend bei all diesen Schadstoffen ist die chronische Exposition, d.h. das permanente Ausgesetztsein, wobei auch langandauernde Belastungen durch niedrige Dosierungen (zum Teil über Jahrzehnte) von Ärzten und Toxikologen mittlerweile als sehr kritisch angesehen werden.
Lösemittel -VOC
Alkohole: Zu den bekanntesten Alkoholen zählt Ethanol, das durch Gärungsprozesse entsteht und in großen Mengen in alkoholischen Getränken enthalten ist. Das Vorkommen von iso-Propanol, Butanol und Ethanol in Wohnräumen ist hauptsächlich auf deren Einsatz in Reinigungsmitteln, Raumluftsprays und Kosmetika zurückzuführen. Höhere Alkohole werden als Lösemittel für Lacke, Farben, Harze, Polituren, Extraktions- und Reinigungsmittel sowie für die Kunststoffherstellung, in Parfümen und Aromastoffen verwendet.
Aromatische Kohlenwasserstoffe sind häufige Lösemittel in Klebern, Dichtmitteln und Anstrichstoffen. Sie sind in fast allen Innenräumen nachzuweisen. Der Richtwert für die Toluolkonzentration in der Außenluft (WHO) von 500 mg/m³ soll seit 1987 auch für den Innenraum angewendet werden. Der MIQ-Wert (Mindestanforderung Innenraumluftqualität) der Hamburger Umweltbehörde liegt bei 400 mg/m³ für Toluol und Xylol. Die ermittelte Konzentration von Toluol sowie die Summe der aromatischen Kohlenwasserstoffe unterschreiten den Richtwert von Toluol der WHO von 500 µg/m³ und den MIQ-Wert der Hamburger Umweltbehörde 400 µg/m³ für Toluol und Xylol in der Summe bei weitem.
Terpene (z.B. Pinen, Caren, Limonen, Myrcen, Citronellol, Longifolen, Campher uvam.) sind allgemein geruchsintensiv. Pinen, Caren, und Limonen sind häufige Terpene und kommen als natürlicher Inhaltsstoff in Hölzern und Kork vor. Quelle von Terpenen in Innenräumen sind neben großflächigen neuen Einbauten von Nadelhölzer vor allem terpenhaltige Anstrichstoffe, Kleber, Verdünner und Oberflächenbehandlungs- und Pflegemittel. Verschiedene Terpene werden auch als Duftstoffe in Putzmitteln und in "Raumluftverbesserern" verwendet.
Aliphaten und Isoaliphaten (Alkane) sind häufige Lösemittelkomponenten in Lacken, Farben, Verdünnern und speziellen Reinigern (Waschbenzine) und Oberflächenbehandlungsmitteln (Holzwachsen). Eine Quelle höhere Aliphate (ab C 15) sind u.a. Haushaltskerzen. Höhere Paraffine tragen zur Ausbidung des Fogging-Phänomens (Magic Dust) bei. Aliphate und
Isoaliphate sind allgemein geruchsarm und mindergiftig.
Silane weisen auf die Verwendung siliconhaltiger Mittel oder Baustoffe hin. Silane und Silikone kommen in vielen Produkten vor (Fugendichtmassen, Anstrichstoffe, Steinbodenöle, sonstige Oberflächenpflegemittel auch für Leder). Orientierungswerte für diese Substanzklasse gibt es noch nicht.
Glykole sind organische Derivate des Ethylenglykols in der zwei H-Atome durch Hydroxygruppen substituiert wurden. Diese Verbindungen werden häufig als Lösungsmittel in wasserbasierten Lacken sowie in lösemittelarmen bzw. lösemittelfreien Teppichklebern ver-wendet. Dabei erlaubt das Umweltbundesamt, dass in Lacken, die den blauen Engel verlie-hen bekommen, bis zu 10 % Glykolverbindungen erhalten sein dürfen. In vielen lösemittelfreien
Teppichklebern werden hochsiedende Glykolverbindungen mit Siedepunkten oberhalb 200 °C verwendet. Diese Hochsieder müssen nicht als Lösungsmittel deklariert werden und die Produkte dürfen somit als "lösemittelfrei" bezeichnet werden. Glykolverbindungen verdunsten aufgrund ihrer meist gegenüber konventionellen Lösemitteln höheren Siedepunkte nur extrem langsam. Durch Glykolverbindungen vorherrschende Belastungen können dabei über lange Zeiträume von Monaten und Jahren hinweg aus Oberflächen ausgasen und stellen somit eine potentielle Langzeitquelle dar. Glykole riechen außerdem nur schwach. Ein weiteres Problem, welches durch die Verwendung von Glykolverbindungen als Lösemittel auftreten kann, sind sogenannte Sekundärkontaminationen. Diese entstehen, wenn relative schwerflüchtige Substanzen über lange Zeit hinweg die Raumluft belasten und sich langsam auf ursprünglich unbelasteten Oberflächen wie Wände und Fußböden oder in Textilien niederschlagen.
Aldehyde und Ketone: Aldehyde enthalten die reaktionsfreudige Aldehydgruppe (-CHO), in Ketonen ist das H-Atom durch einen weiteren aliphatischen und aromatischen Rest substituiert. Sie sind Zwischenprodukte bei der Herstellung von Kunststoffen, Lösungsmitteln, Farbstoffen, Parfümen und Gerbereibedarfsartikeln. Aldehyde sind sehr geruchsintensiv, insbesondere n-Hexanal stellt eine Leitkomponente dar. Quellen sind Materialien aus Holz bzw. zellulosischem Material wie Paneele, Laminat, Fertigparkett oder OSB-Platten, bei denen die Aldehyde produktionsbedingt aus Restbeständen von Harzen entstehen und Produkte auf Basis von Leinöl, das beispielsweise als Bindemittel in Naturfarben und zur Herstellung von Linoleum eingesetzt wird.
Ketone wie z.B. Methylethylketon, Aceton oder Diethylketon sind klare, leichtflüchtige Lösemittel mit charakteristischem Geruch und werden häufig in Klebstoffen (Allesklebern) und als Universal-Lösungsmittel eingesetzt. Auch Nagellackentferner enthält in der Regel größere Mengen Aceton.
Ester sind chemische Verbindungen, die aus einem Alkohol und einer organischen oder anorganischen Säure unter Wasserabspaltung entstehen (Veresterung). Diese Substanzen dienen in der Getränkeindustrie als Fruchtessenzen, in der Parfümerie als Geruchsstoffe und werden als Lösungsmittel für Kleber, Farben, Lacke und Harze eingesetzt. Sie werden vor allem in lösungsmittelarmen Systemen wie "Wasserlacken", Dispersionsfarben oder Dispersionsklebern verwendet, um den Gehalt leichtflüchtiger Lösemittelbestandteilen aus Arbeitsschutzgründen zu vermindern. Ihr Gehalt der Innenraumluft ist deshalb in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Ester können auf zu feuchten Estrichen hydrolisieren und allmählich zu den entsprechenden Aldehyden (Ethylhexanal) oxidiert werden. Höhere aliphatische Aldehyde weisen im Gegensatz zu Furfural und Benzaldehyd eine vergleichsweise geringe Toxizität auf.
Formaldehyd
Krebserregende Wirkung von eingeatmetem Formaldehyd hinreichend belegt
Formaldehyd ist gesundheitsschädlich, es reizt die Schleimhäute und kann Krebs im Nasenrachenraum auslösen, wenn es eingeatmet wird. Das ist das Ergebnis einer Bewertung neuer Studien, die das Bundesinstitut für Risikobewertung heute (29.05.2006) der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Das Institut sieht es als hinreichend bewiesen an, dass die Substanz im Nasenrachenraum Tumore auslösen kann, wenn sie eingeatmet wird, und schlägt deshalb eine Änderung der geltenden Einstufung vor.
Bei Formaldehydkonzentrationen über 0,02 ppm in der Raumluft sind Beeinträchtigungen des Wohlbefindens und formaldehydtypische Beschwerden bei längerer Exposition und entsprechender Konstitution nicht auszuschließen. Bei einer bereits erworbenen Allergie kann es bei noch geringeren Formaldehydkonzentrationen zu Beschwerden kommen.
Wirkung: reizt die Schleimhäute, sensibilisierend, erbgutverändernd, krebserzeugend, Allergiepromotor bei Menschen. Die Schädigung beginnt bereits weit unterhalb der Geruchsschwelle (0,05 ppm).
Die International Agency for Research on Cancer in Lyon, eine zur Weltgesundheitsorganisation gehörende Forschungseinrichtung, hat den Stoff mittlerweile in die höchste Risikogruppe eingestuft: "krebserregend für den Menschen".
Das Gas dünstet aus formaldehydhaltigen Leimen und Bindemitteln (früher in größeren Mengen vor allem aus Spanplatten von Billigmöbeln und Wand- und Bodenaufbauten) aus und ist auch in geringen Mengen schädlich für die Gesundheit.
Der Formaldehyd-Grenzwert für den Innenraum, dem im Alltag auch Säuglinge, Kleinkinder und Kranke ausgesetzt sein dürfen, liegt derzeit bei 0,1 ppm Raumluft (Stand 1977 BGA, jetzt UBA), was von Seiten erfahrener Umweltmediziner und internationaler Wissenschaftler für zu hoch erachtet wird, da empfindliche Personen nachweislich bereits bei der Hälfte dieses Wertes reagieren.
Hilft regelmäßiges Lüften?
Regelmäßiges Lüften mindert lediglich die Belastung, auch beim Renovieren. Lüften bei Belastung heißt: Durchzug (Querlüften), alle Fenster und Türen weit auf. Die erforderliche Luftwechselrate von einmal pro Stunde darf nicht unterschritten werden. Die Energiesparverordnung mag ökonomisch und ökologisch sinnvoll sein, sie darf aber nicht auf Kosten der Gesundheit gehen. Frische Luft ist lebenswichtig.
Entscheidend bei der Reduzierung von Bioziden in der Wohnung ist neben der Beseitigung der Quelle der richtige Staubsauger. Er sollte unbedingt über einen HEPA-Filter Nr. 13 oder besser Nr. 14 verfügen. „Normale“ Staubsauger verteilen das Problem in der ganzen Wohnung, da sie die giftigen Mikropartikel nicht festhalten können.